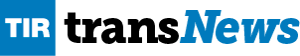Wasserstoff-Pilotprojekt unter realen Bedingungen
LEUCHTTURMPROJEKT Die Freiburgischen Verkehrsbetriebe TPF zeigen Pioniergeist und starten ein Pilotprojekt mit zwei Mercedes-Benz eCitaro G fuel cell Brennstoffzellenbussen, die unter realen Bedingungen zum Einsatz kommen. Unterstützung kommt u.a. aus dem Förderprogramm der Stiftung KliK.

Die TPF feiern 2025 nicht nur ihr Wasserstoff-Pilotprojekt, sondern offiziell auch ihr 25-jähriges Bestehen: Im Jahr 2000 haben sich die beiden freiburgischen Transportunternehmen GFM und TF zu einem einzigen Unternehmen zusammengeschlossen: die Freiburgischen Verkehrsbetriebe (TPF) sind heute das zehntgrösste öffentliche Transportunternehmen der Schweiz mit dem Auftrag, Reisende sicher und mit einer hohen Servicequalität zu befördern.
Die TPF sehen ihr Engagement für eine «Mobilität der Zukunft» als eine ihrer Kernaufgaben an und setzen bereits zahlreiche Massnahmen um. Dazu gehören der geplante Ersatz aller Dieselbusse durch Elektro- oder Wasserstoffbusse genauso wie Solaranlagen auf den betriebseigenen Immobilien, die Förderung von Biodiversitätsflächen entlang der Bahngeleise oder die Thematisierung von Nachhaltigkeit in der Belegschaft, in Ausbildungen und Schulungen.

Multimodalität als Markenzeichen
Die TPF-Flotte setzt sich aus Rollmaterial für den Bahnverkehr (Normal- und Schmalspurbahn) und den Strassenverkehr zusammen. Die verschiedenen Busmodelle sind aufgeteilt in 167 Regional- und 65 Stadtbusse, davon 24 Trolley- und 5 Elektrobusse. In der Mehrmarkenstrategie sind die Modelle von Mercedes-Benz stark vertreten. So wurden im Dezember 2024 24 batterieelektrische Mercedes-Benz eCitaro bestellt, die im Dezember 2026 in Betrieb genommen werden. Es handelt sich dabei um 18-Meter-Gelenkbusse und 12-Meter-Schnellladebusse.
Zwischenzeitlich hat sich die TPF für ihre Dekarbonisierungspläne den Rückhalt der Bevölkerung gesichert. Das Freiburger Stimmvolk stimmte im März 2024 einer Erhöhung des Eigenkapitals der TPF um 60 Mio. Franken zu. Dieser Erhöhung folgten auch die beiden anderen Hauptaktionäre, nämlich die Stadt Freiburg (12,5 Mio.) und die SBB (3,8 Mio.). Diese Mittel versetzen die TPF in die Lage, in neues, lokal emissionsfreies Rollmaterial zu investieren, und zwar mit einer geringeren Zinsbelastung für die Besteller.

Wasserstoff-Pilotprojekt begann vor vier Jahren
Bereits 2021 schlossen sich die TPF und der Energieversorger Groupe E in einem wegweisenden Projekt zugunsten der nachhaltigen Mobilität zusammen. An ihrem Standort in Givisiez planten die TPF die Inbetriebnahme einer mobilen Slow-Filling-Wasserstofftankstelle sowie den Betrieb von zwei Bussen mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb, mit einem dritten Fahrzeug als Option. Groupe E sollte die Versorgung mit grünem Wasserstoff aus 100 Prozent erneuerbarer Energie sicherstellen, und die Tankstelle sollte auch für Busse und Lkw anderer Unternehmen in der Region ausbaubar sein.
Heute, vier Jahre später, haben sich die Parameter für das Wasserstoff-Pilotprojekt etwas verändert, wie uns Thomas Hans, Technischer Leiter Technik Strassenfahrzeuge, erklärt: «Anfang 2025 erhielten wir die Baugenehmigung und hätten die Tankstelle im letzten Quartal 2025 eröffnen können. Die Agglomeration Freiburg hat jedoch eine Beteiligung im mittleren sechsstelligen Bereich abgelehnt, die die Finanzierung der Mehrkosten für den Betrieb der neuen Busse ermöglichen sollte. Bis wir eine Lösung gefunden haben, um diese Finanzierungslücke zu schliessen, werden wir jeweils bei der öffentlichen Station der Schwab-Guillod AG in Müntschemier tanken.»

Was der eCitaro fuel cell besser kann
Einer der Trümpfe der TPF ist ihr selbst entwickeltes Simulationsprogramm, das bei der Umstellung auf emissionsfreie Antriebe eine wichtige Rolle spielt. Das Wasserstoffbus-Projekt, das nun in die operative Phase tritt, soll helfen, eine nachhaltige Mobilität zu entwickeln und den Übergang zu einer Flotte ohne CO₂-Emissionen zu vollziehen. Eine der Herausforderungen dabei ist der kurze Stadtlinientakt von unter 10 Minuten. Die für Zwischenladungen verfügbare Zeit ist für Elektrobusse äusserst knapp. Kommt es dann zu Verzögerungen, etwa infolge hohem Verkehrsaufkommens, braucht es zusätzliche Busse, um den Auftrag sicherstellen zu können. In diesem Szenario zeigt sich der H2-Bus überlegen, wie Hans ausführt: «Grundlegend kann der Brennstoffzellenbus grössere Strecken ohne längere Pausen, also ohne elektrische Zwischenladung, bewältigen. Ausserdem kann der eCitaro fuel cell als Hybridbus – er ist Batterie- und Wasserstoffbus in einem – auch in Stosszeiten kleinere Strecken rein elektrisch bewältigen. Dies hilft uns, die Kosten zu optimieren.»
Tatsächlich sei die Brennstoffzellen-Version des eCitaro mit rund 960.000 Franken nicht viel teurer als der Standard-Batteriebus. Kopfzerbrechen mache da eher der heute noch hohe Preis von grünem Wasserstoff mit aktuell rund 20 Franken pro Kilogramm. «Aber aufgrund unserer Simulationen wissen wir, dass die ganze Flotte nicht durch aktuell erhältliche Elektrobusse ersetzt werden kann. Das Pilotprojekt mit dem eCitaro fuel cell hilft uns deshalb, diese in der Theorie funktionierende und kostenoptimierte Lösung im realen Einsatz zu bestätigen.» Denn, obwohl es sich um Serienfahrzeuge handelt, gab und gibt es weiterhin verschiedene Hürden zu meistern. Zu den technischen Herausforderungen kommen die Finanzierung, der Mangel an Gesetzen und Verordnungen sowie auch die Veränderungen für Mitarbeitende hinzu.

Auffallend komfortabel
Ohne das Feingefühl und Können des Chauffeurs schmälern zu wollen, zeigte eine kurze Testfahrt durch die malerische Freiburger Altstadt einmal mehr, wie angenehm es sich im eCitaro fährt. Ob auf glattem Asphalt oder Kopfsteinpflaster, bei starker Steigung oder einfach geradeaus und durch Kurven: Als Passagier geniesst man auch im Wasserstoffbus maximalen Komfort. Auffallend waren zudem die Blicke von Passanten, deren Aufmerksamkeit der brandneue Bus erregte.
«Nach einer kurzen Testphase werden wir die Fahrzeuge unter realen Bedingungen auf verschiedenen Linien betreiben», so Hans abschliessend. «Für das Wasserstoff-Pilotprojekt wurden Strecken gewählt, die ohne tiefgreifende Veränderungen heute nicht mit einem Batteriebus realisierbar sind. Diese Fahrzeuge werden uns im besten Fall die nächsten zehn Jahre begleiten.»